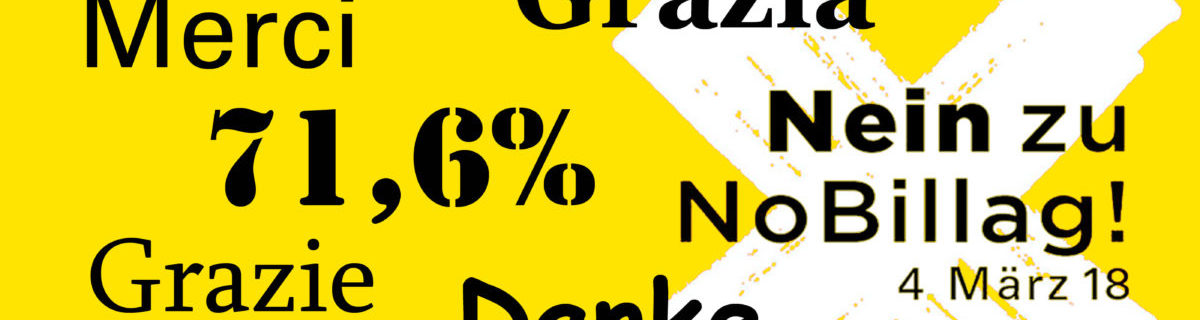Der SRG-Direktor Gilles Marchand ist dabei, den Liquidationsprozess im Falle einer Annahme von «No Billag» vorzubereiten. Er sagt, welche Fragen ihn derzeit umtreiben. Nina Fargahi und Alain Maillard von der Medienzeitschrift EDITO haben mit ihm gesprochen.

SRG-Direktor Gilles Marchand (Bildquelle: RTS)
EDITO: Die Kampagne «No Billag» ist in vollem Gang und der SRG sind aufgrund ihrer politischen Neutralität die Hände gebunden. Können Sie uns etwas über die Strategie der SRG erzählen?
Gilles Marchand: Natürlich können wir die öffentlichen Mittel nicht für eine Kampagne einsetzen, aber andere werden für uns sprechen. Spätestens ab Januar werden sich einige weitere Institutionen und Organisationen gegen «No Billag» einsetzen, um die Konsequenzen in verschiedenen Bereichen darzulegen: Sport, Kultur, Film, Volksmusik, Schulen, Wissenschaft und so weiter. Alle diese Kreise sind von der Abstimmung betroffen und ich hoffe, dass sie nicht schweigen werden.
Es gibt viele Stimmen, wonach die Annahme der Initiative keine Katastrophe wäre. Wie erklären Sie sich diesen Relativismus?
Es gibt zwei Gruppen: Diejenigen, die die Radikalität der Initiative noch nicht verstanden haben. Und diejenigen, wie zum Beispiel einige private Akteure, die mit uns vermeintlich konkurrieren. Sie sind der Ansicht, dass eine schwächere SRG ihre Situation stärken würde. Das ist ein Fehler in der Analyse, denn ohne SRG verlieren alle.
Auch Bundesrat Ueli Maurer sagt, die Schweiz würde nicht untergehen bei einer Annahme.
Nein, die Alpen werden noch stehen. Es wäre aber der Untergang einer bestimmten Idee von der Schweiz, die in ihre unterschiedlichen Sprachen und Kulturen investiert. Würde es in der italienischsprachigen Schweiz ein Radio und Fernsehen geben ohne gebührenfinanzierte SRG? In der Romandie? In der rätoromanischen Schweiz? Es ist sehr wichtig, dass es Journalismus gibt in unserem Land, der sich keinem wirtschaftlichen oder politischen Druck beugen muss. Die SRG stellt dies heute sicher.
Kritiker monieren, dass keine Debatte über den Service public stattfindet.
Das ist eine «Urban Legend». In meinem Presseservice erhalte ich alles, was über die SRG geschrieben wird. Ich glaube, in kaum einem anderen Land in Europa wird so viel über den Service public geschrieben, diskutiert und debattiert – seine Rolle, seinen Umfang, seine Finanzierung, seine Beziehung zu privaten Akteuren und so weiter. Aber ich stimme den Kritikern zu, dass diese Debatten besser organisiert werden sollten. Das ist auch der Grund für das Projekt «Contribution to Society», das die SRG nach der Abstimmung lancieren wird. Es geht darum, den Dialog zu strukturieren, konstruktiv zu gestalten und zu präsentieren. Wir werden noch lange über den Service public sprechen, und das ist gut so.
Der Vorteil der gegenwärtigen Situation ist, dass sich die ganze SRG selbst hinterfragt. Es gibt einen Wunsch nach Veränderung, auch wenn wir am 4. März gewinnen. Das Unternehmen hat verstanden, dass es nicht statisch bleiben kann; mein Job wird es auch sein, nach der Abstimmung neue Lösungsvorschläge auf den Tisch zu bringen.
Können Sie sagen, wie diese Lösungsvorschläge aussehen werden?
Das werden wir zu gegebener Zeit tun. Vorderhand konzentrieren wir uns voll und ganz auf unseren Auftrag, gute und unabhängige Programme für alle Altersklassen in allen Sprachregionen der Schweiz zu machen.
Warum sind Sie nicht bereit, Forderungen nachzukommen wie zum Beispiel der Austritt aus Admeira?
Wer sagt, dass die SRG nicht bereit ist, Forderungen nachzukommen? Die Frage ist, wo und wie. Nehmen wir zum Beispiel die Service-public-Konferenz des Verbandes Schweizer Medien von Mitte November in Bern. Es herrschte ein de-struktives Klima und in einem solchen Kontext ist keine ernsthafte Diskussion möglich. Schliesslich ging es nicht darum, einen Weihnachtskalender zu präsentieren. Für pragmatische und professionelle Lösungen, ob im kommerziellen oder inhaltlichen Bereich, bin ich immer offen.
Sind also keine spektakulären Ankündigungen vonseiten der SRG im Vorfeld der Abstimmung zu erwarten?
Alles ist möglich. Wir sind fortlaufend mit den Verlegern zu diversen Themen im Gespräch. In der Westschweiz haben RTS und die Privaten zum Beispiel eine Charta der Zusammenarbeit unterzeichnet; diese Form der Zusammenarbeit wäre vielleicht auch in der deutschsprachigen Schweiz denkbar.
Sie haben noch nicht erwähnt, dass «No Billag» das Ende der SRG bedeuten würde.
Seien wir uns darüber klar: Falls die Initiative angenommen wird, würde dies das Ende der SRG bedeuten. Daran gibt es gar keine Zweifel.
Wäre es nicht denkbar, dass die SRG eine neue Konzession erhält, die ihr mehr kommerzielle Ressourcen – Werbung im Radio, im Internet – erlaubt?
Meine Antwort ist nicht politisch, sondern berufsbezogen. Es ist unmöglich, ohne öffentliche Mittel das SRG-Angebot in allen Sprachregionen am Markt zu finanzieren. Vielleicht gäbe es da und dort ein paar aufstrebende Initiativen oder thematische Kanäle, die irgendwie in einer Sprachregion überleben könnten. Zum Beispiel ein beliebter Musikkanal in St. Gallen oder Ähnliches. Aber die SRG gemäss heutiger Definition ist ein vollständiger Dienst für die gesamte Öffentlichkeit, die nicht fortbestehen könnte mit der Annahme von «No Billag».
Es könnte ein neuer Verein entstehen, der eine Konzession mit einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag hätte?
Wie stellen Sie sich ein öffentliches Dienstleistungsmandat ohne öffentliche Finanzierung vor? Jeder Private wird Ihnen sagen: Wenn ich kein öffentliches Geld habe, möchte ich niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig sein und nur dort investieren, wo es rentiert. Warum sind die 34 Radio- und Fernsehsender, die Gebührengelder erhalten, so sehr besorgt? Weil sie auf die Finanzierung angewiesen sind, die von der Lizenzgebühr kommt, und ihre Konzession beinhaltet ebenfalls Rechte und Pflichten im Bereich des Service public.
Also arbeiten Sie nicht an einem Plan B?
Der einzige Plan B im Falle einer Annahme von «No Billag» ist ein geregelter Abbau. Das heisst, innerhalb von wenigen Monaten müssten wir die Kündigungen organisieren und die Einrichtungen auflösen. Damit können wir nicht bis zum 5. März zuwarten; diesen Liquidationsprozess müssen wir mit dem Bund vorbesprechen.
Befürworter der Initiative sagen, Sie würden den Teufel an die Wand malen.
Die Vorbereitungen, um ein Unternehmen mit 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzulösen, sind sehr schwierig und belastend. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel, sondern eine schwere Verantwortung. Eine SRG ohne öffentliche Finanzierung ist nicht möglich. Keine Unterstützung mehr für Musik und Film, keine Dokumentarfilme, keine Leistungen mehr für sinnesbehinderte Mitmenschen… Das Unternehmen müsste liquidiert werden.
Die Frage ist, wie und in welcher Reihenfolge. Wird es eine sofortige Insolvenz sein oder ein fortschreitender Abbau? Wie sieht es mit einem Sozialplan aus? Es gibt viele Fragen, die geklärt werden müssen. Die Schweizer Medienszene müsste sich von dieser Katastrophe erst wieder erholen und neu erfinden.
Sind Sie heute mehr beunruhigt als zu Ihrem Dienstbeginn?
Nein. Ich habe die Stelle im Wissen um die kommenden Stürme angenommen und kenne die Situation von innen. Was ich mit etwas mehr Schärfe neu entdecke, ist das Beziehungsklima gegenüber der SRG in der Deutschschweiz. In der Romandie ist die Beziehung zum Service public anderer Natur: Dort ist man enger mit der SRG als Institution verbunden, die man auch als Ausdruck des kollektiven Zusammenhalts versteht. Das hat historische, soziologische und kulturelle Gründe.
Inwiefern greifen in diesem Zusammenhang rationale Argumente über die Konsequenzen von «No Billag», wie Sie sie formulieren?
Die Überzeugungsarbeit muss auf verschiedene Arten gleichzeitig stattfinden. Einerseits muss man die Fakten klar nennen, wie zum Beispiel: Über 13 000 Vollzeitstellen hängen in der Schweiz direkt oder indirekt vom medialen Service public ab und wären im Falle einer Annahme der Initiative direkt oder indirekt bedroht. Andererseits gibt es auch emotionale Argumente: Viele Schweizerinnen und Schweizer sind schliesslich mit SRG-Sendungen aufgewachsen.
zurück
Dieser Artikel ist in der Zeitschrift EDITO 06/2017 erschienen. Ein Dossier zu NoBillag wurde unter www.edito.ch publiziert.